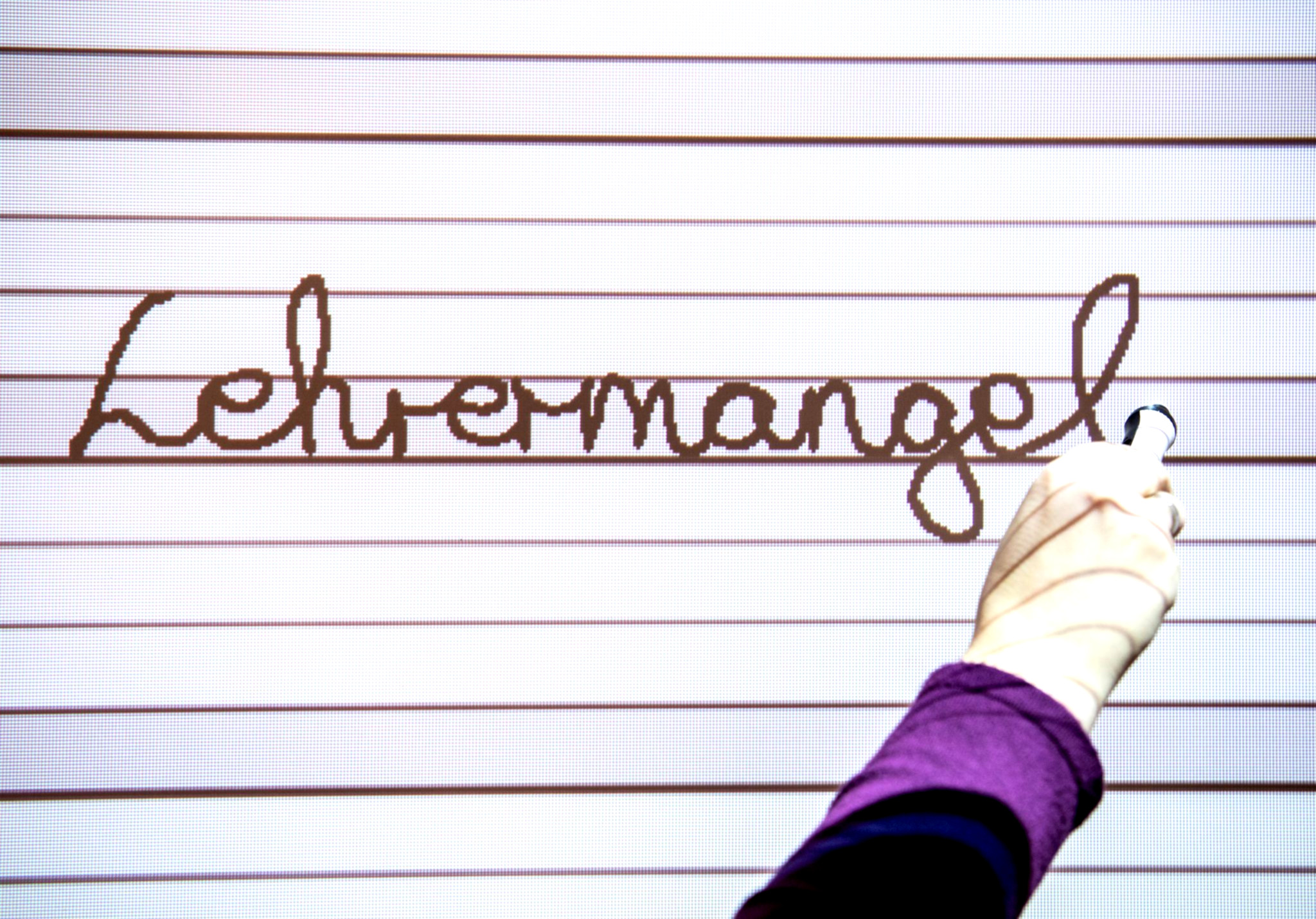
In Hessen wird der Lehrermangel, der seit Jahren ein zentrales Thema der bildungspolitischen Debatten in Deutschland ist, im Jahr 2025 besonders akut. Ein deutliches Zeichen setzen drei Schulleitungsverbände, der Grundschulverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit der Vorstellung der Sechsten Frankfurter Erklärung: Die Herausforderungen, vor denen hessische Schulen stehen, sind komplex, aber der Mangel an qualifiziertem Personal und die Probleme im Bereich der Digitalisierung sind die zentralen Punkte. Angesichts gesellschaftlicher und technologischer Veränderungen steigt der Druck auf die Bildungseinrichtungen, über die Sicherstellung der Unterrichtsversorgung hinaus neue Kompetenzen zu vermitteln. Die Anliegen der Verbände spiegeln nicht nur die Ängste der Lehrkräfte wider, sondern auch die Hoffnungen von Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie der gesamten Öffentlichkeit.
Die Diskussion über den Lehrermangel wird von Zahlen dominiert, die die gegenwärtige Lage veranschaulichen: Erhebungen der Landesregierung zeigen, dass in Hessen viele Stellen unbesetzt sind, vor allem an Grundschulen und in ländlichen Gebieten. Außerdem erreichen viele Lehrkräfte in den kommenden Jahren das Pensionsalter, und der Nachwuchs aus den Universitäten ist nicht ausreichend, um die entstandenen Lücken zu füllen. Die Belastung des vorhandenen Personals steigt kontinuierlich, was die Berufswahl weniger attraktiv macht. Die Forderung nach einer umfassenden Digitalisierung der Schulen wird gleichzeitig immer lauter. Die Jahre der Pandemie haben deutlich gemacht, wie wichtig moderne Technologien und digitale Fähigkeiten sind – und wie groß die Rückstände an vielen Schulen noch immer sind.
Die Sechste Frankfurter Erklärung ist in diesem Zusammenhang mehr als nur ein Forderungskatalog; Sie verkörpert ein breites Bündnis, das einen grundlegenden Wandel im Bildungssystem fordert. Die Unterzeichner fordern nicht nur umgehende Maßnahmen gegen den Lehrermangel, sondern auch strukturelle Reformen, die langfristig die Qualität und Chancengleichheit im Bildungswesen sichern. Hierzu gehören Investitionen in die Lehrkräfteausbildung, die Optimierung der Arbeitsbedingungen, gezielte Initiativen zur Gewinnung von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern sowie die Bereitstellung moderner technischer Ausstattung und professioneller IT-Unterstützung an allen Schulen. Sie sieht sich als ein Aufruf an die Politik und die Gesellschaft, Bildung als eine zentrale Zukunftsaufgabe zu erkennen und entsprechend zu handeln.
Die Debatte dreht sich um die Frage, wie man die Situation langfristig verbessern kann. Es besteht Einigkeit zwischen den politisch Verantwortlichen, den Verbänden und den Betroffenen, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Es braucht vielmehr ein Bündel von Maßnahmen, das kurzfristige Engpässe behebt und gleichzeitig die Grundlagen für eine zukunftsorientierte Schullandschaft schafft. Eine detaillierte Betrachtung der Hintergründe, der aktuellen Herausforderungen sowie der Forderungen und Lösungsansätze der Verbände folgt im Detail.
Der Lehrermangel in Hessen: Ursachen, Ausmaß und regionale Unterschiede
In den vergangenen Jahren hat sich der Lehrermangel in Hessen kontinuierlich verschärft; er ist mittlerweile eine der größten Herausforderungen, die das Bildungswesen im Jahr 2025 bewältigen muss. Den Informationen des Hessischen Kultusministeriums zufolge fehlen derzeit mehrere tausend Lehrkräfte, wobei vor allem Grundschulen und weiterführende Schulen in ländlichen Gebieten betroffen sind. Während Städte wie Frankfurt am Main oder Wiesbaden eine bessere Versorgung genießen, haben viele ländliche Kreise offene Stellen, die sich trotz mehrmaliger Ausschreibungen nicht besetzen lassen.
Eine der Hauptursachen ist die demografische Entwicklung: Die Lehrkräfte der geburtenstarken Jahrgänge ziehen zunehmend in den Ruhestand, während der Bedarf an Lehrpersonal durch steigende Schülerzahlen wächst. Die Situation an Grundschulen ist besonders kritisch, weil eine große Pensionierungswelle bevorsteht und der Nachwuchs an ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern fehlt. Die Universitäten können die Nachfrage kaum erfüllen, weil die Zahl der Absolventinnen und Absolventen in den Lehramtsstudiengängen seit Jahren stagnieren oder sogar rückläufig ist.
Ein weiterer Aspekt ist, dass der Beruf vor allem in strukturschwachen Gebieten wenig attraktiv ist. Geringere Gehälter als in anderen Bundesländern, eine hohe Arbeitsbelastung und das Fehlen von Aufstiegschancen sind Gründe, warum viele potenzielle Bewerber abgeschreckt werden. Lange Pendelwege, fehlende Infrastruktur und ein Mangel an Wohnraum tragen außerdem dazu bei, dass es schwierig ist, Stellen im ländlichen Raum zu besetzen. Das Ergebnis ist eine ungleiche Lehrkräfteverteilung, die die Bildungsungleichheit zwischen Stadt und Land weiter verschärft.
Es gibt zusätzliche Schwierigkeiten in sogenannten Mangelfächern wie Mathematik, Naturwissenschaften und Fremdsprachen. Immer weniger gelingt es den Schulen, qualifiziertes Personal zu gewinnen, was direkte Auswirkungen auf die Unterrichtsversorgung und die Unterrichtsqualität hat. Es kommt sogar vor, dass Fächer gestrichen oder mit fachfremdem Personal besetzt werden müssen, was die Belastung der verbleibenden Lehrkräfte zusätzlich erhöht.
Um die Schulen erfolgreich zu digitalisieren, ist es unerlässlich, dass wir einen professionellen IT-Support sicherstellen. Ohne diese Hilfe laufen kostspielige Investitionen ins Leere und die Lehrkräfte verlieren weiter ihre Motivation. Die Verbände erkennen hier einen dringenden Handlungsbedarf und verlangen, dass die Landesregierung dies klar priorisiert.
In den letzten Jahren hat die hessische Landesregierung unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, wie etwa die Schaffung zusätzlicher Studienplätze, die Einstellung von Quereinsteigern und die Unterstützung von Teilzeitkräften. Diese Maßnahmen sind jedoch bislang nicht ausreichend, um die Lücken nachhaltig zu schließen. Aus diesem Grund verlangen die Verbände ein langfristiges und umfassendes Handlungskonzept, das neue Lehrkräfte gewinnen und die Arbeitsbedingungen verbessern soll.
Belastung und Motivation der Lehrkräfte: Arbeitsalltag unter Druck
In Hessen sind die Lehrerinnen und Lehrer zunehmend mit Herausforderungen und einer wachsenden Arbeitsbelastung konfrontiert, die direkt aus dem Lehrermangel resultiert. Eine aktuelle Untersuchung des Instituts für Schulentwicklungsforschung an der Technischen Universität Dortmund, die hessische Schulen im Jahr 2025 mit einbezieht, belegt, dass Lehrkräfte im Durchschnitt deutlich mehr Überstunden machen, als es ihr Arbeitsvertrag vorsieht. Grund- und Förderschulen sind besonders betroffen, weil dort das Personal oft mehrere Klassen oder Fächer gleichzeitig abdecken muss.
Die Auswirkungen von Personalengpässen sind unterschiedlich: Unterrichtsausfälle, größere Klassen, mehr Vertretungsstunden und eine erhöhte Belastung durch administrative Aufgaben sind einige davon. Viele Lehrkräfte äußern, dass sie sich überfordert und nicht wertgeschätzt fühlen. Die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler sowie die Entwicklung neuer Unterrichtskonzepte bleiben kaum noch Zeit, was die pädagogische Arbeit leidet. Die Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf und die Umsetzung von Inklusion sind besonders anspruchsvoll für das Personal.
Die Auswirkungen von Personalengpässen sind unterschiedlich: Unterrichtsausfälle, größere Klassen, mehr Vertretungsstunden und eine erhöhte Belastung durch administrative Aufgaben sind einige davon. Viele Lehrkräfte äußern, dass sie sich überfordert und nicht wertgeschätzt fühlen. Die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler sowie die Entwicklung neuer Unterrichtskonzepte bleiben kaum noch Zeit, was die pädagogische Arbeit leidet. Die Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf und die Umsetzung von Inklusion sind besonders anspruchsvoll für das Personal.
Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit: Auswirkungen von Lehrermangel und Digitalisierung
In Hessen sind die Bildungsgerechtigkeit und die Chancengleichheit direkt betroffen von dem Lehrermangel und der ungleichen Digitalisierung der Schulen. Im Jahr 2025 wird deutlich, dass die Ungleichheit zwischen gut ausgestatteten Schulen in wohlhabenden Gebieten und den benachteiligten Bildungseinrichtungen immer größer wird. Besonders Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien oder mit Migrationshintergrund leiden unter den strukturellen Defiziten.
In Hessen sind die Bildungsgerechtigkeit und die Chancengleichheit direkt betroffen von dem Lehrermangel und der ungleichen Digitalisierung der Schulen. Im Jahr 2025 wird deutlich, dass die Ungleichheit zwischen gut ausgestatteten Schulen in wohlhabenden Gebieten und den benachteiligten Bildungseinrichtungen immer größer wird. Besonders Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien oder mit Migrationshintergrund leiden unter den strukturellen Defiziten.
Auch die psychosoziale Belastung wächst. Die Frustration, die sich aus dem Gefühl speist, den eigenen Ansprüchen sowie den Erwartungen von Eltern und Gesellschaft nicht mehr gerecht zu werden, kann bei vielen Lehrkräften gesundheitliche Probleme bis hin zu einem Burnout verursachen. In den letzten Jahren hat die Anzahl der krankheitsbedingten Ausfälle deutlich zugenommen, was den Druck auf die Kolleginnen und Kollegen erhöht, die noch da sind.
Auch die psychosoziale Belastung wächst. Die Frustration, die sich aus dem Gefühl speist, den eigenen Ansprüchen sowie den Erwartungen von Eltern und Gesellschaft nicht mehr gerecht zu werden, kann bei vielen Lehrkräften gesundheitliche Probleme bis hin zu einem Burnout verursachen. In den letzten Jahren hat die Anzahl der krankheitsbedingten Ausfälle deutlich zugenommen, was den Druck auf die Kolleginnen und Kollegen erhöht, die noch da sind.
Aus diesem Grund verlangen die Verbände nicht nur, dass die Schulen besser personell ausgestattet werden, sondern auch, dass es gezielte Maßnahmen zur Entlastung und Unterstützung der Lehrkräfte gibt. Das umfasst unter anderem den Ausbau von multiprofessionellen Teams, die Bereitstellung von Schulsozialarbeitern und Schulpsychologen sowie die Einrichtung von Zeitkontingenten für Fortbildung und kollegiale Beratung. Es ist der einzige Weg, um die Lehrkräfte langfristig zu motivieren und die Unterrichtsqualität zu sichern.
Aus diesem Grund verlangen die Verbände nicht nur, dass die Schulen besser personell ausgestattet werden, sondern auch, dass es gezielte Maßnahmen zur Entlastung und Unterstützung der Lehrkräfte gibt. Das umfasst unter anderem den Ausbau von multiprofessionellen Teams, die Bereitstellung von Schulsozialarbeitern und Schulpsychologen sowie die Einrichtung von Zeitkontingenten für Fortbildung und kollegiale Beratung. Es ist der einzige Weg, um die Lehrkräfte langfristig zu motivieren und die Unterrichtsqualität zu sichern.
Quereinstieg und Nachwuchsgewinnung: Chancen und Herausforderungen
Um dem akuten Lehrermangel zu begegnen, setzt Hessen zunehmend auf Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, um die offenen Stellen zu besetzen. Die Verbände begrüßen dieses Instrument grundsätzlich, aber sie betrachten die Qualität der Ausbildung und die Integration der neuen Lehrkräfte als entscheidend. Im Jahr 2025 sind Quereinsteiger bereits ein erheblicher Teil der Neueinstellungen, besonders in Mangelfächern und an Grundschulen.
Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Unterstützung der digitalen Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler. Ein fester Bestandteil des Unterrichts sollte die Lehre über Medienkompetenz, kritisches Denken und ein verantwortungsbewusster Umgang mit digitalen Medien sein. Nur so können wir garantieren, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen haben, an der digitalen Gesellschaft teilzuhaben.
Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Unterstützung der digitalen Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler. Ein fester Bestandteil des Unterrichts sollte die Lehre über Medienkompetenz, kritisches Denken und ein verantwortungsbewusster Umgang mit digitalen Medien sein. Nur so können wir garantieren, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen haben, an der digitalen Gesellschaft teilzuhaben.
Über den Quereinstieg können Personen mit Hochschulabschluss, aber ohne Lehramtsstudium, in den Schuldienst kommen. In den letzten Jahren hat die Landesregierung die Zugangsvoraussetzungen erleichtert und spezielle Qualifizierungsprogramme eingerichtet. Sie sind vor allem für Akademikerinnen und Akademiker der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sowie für Muttersprachlerinnen und Muttersprachler im Fremdsprachenunterricht gedacht.
Politische Reaktionen und Maßnahmen: Was tut die Landesregierung?
Die Erfahrungen mit Quereinsteigern sind unterschiedlich. Einerseits haben sie neue Blickwinkel und unterschiedliche Berufserfahrungen, andererseits mangelt es ihnen oft an der pädagogischen und didaktischen Ausbildung, die für den schulischen Alltag unerlässlich ist. Die Einarbeitung ist nur dann erfolgreich, wenn sie mit gezielten Fortbildungen, Mentoring-Programmen und einer engen Begleitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen unterstützt wird. Ohne diese Interventionen besteht das Risiko, dass Quereinsteiger den Beruf schnell wieder verlassen oder nicht den gewünschten Unterricht erteilen können.
Die Erfahrungen mit Quereinsteigern sind unterschiedlich. Einerseits haben sie neue Blickwinkel und unterschiedliche Berufserfahrungen, andererseits mangelt es ihnen oft an der pädagogischen und didaktischen Ausbildung, die für den schulischen Alltag unerlässlich ist. Die Einarbeitung ist nur dann erfolgreich, wenn sie mit gezielten Fortbildungen, Mentoring-Programmen und einer engen Begleitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen unterstützt wird. Ohne diese Interventionen besteht das Risiko, dass Quereinsteiger den Beruf schnell wieder verlassen oder nicht den gewünschten Unterricht erteilen können.
Die Gewinnung von Nachwuchs bleibt auch mit Quereinstieg eine zentrale Herausforderung. Die Anzahl der Lehramtsstudierenden bleibt konstant, und viele von ihnen wählen während ihres Studiums einen anderen Berufsweg. Die hohe Arbeitsbelastung, die lange Ausbildungszeit und die häufig als unattraktiv geltenden Arbeitsbedingungen sind dafür verantwortlich. Gerade in den Mangelfächern ist es selten, dass genügend Absolventen gewonnen werden können.
Die Gewinnung von Nachwuchs bleibt auch mit Quereinstieg eine zentrale Herausforderung. Die Anzahl der Lehramtsstudierenden bleibt konstant, und viele von ihnen wählen während ihres Studiums einen anderen Berufsweg. Die hohe Arbeitsbelastung, die lange Ausbildungszeit und die häufig als unattraktiv geltenden Arbeitsbedingungen sind dafür verantwortlich. Gerade in den Mangelfächern ist es selten, dass genügend Absolventen gewonnen werden können.
Deshalb verlangen die Verbände eine fokussierte Imagekampagne für den Lehrerberuf, bessere Ausbildungsbedingungen und mehr finanzielle Unterstützung für Lehramtsstudierende. Außerdem empfehlen sie, neue Zielgruppen für den Beruf zu erschließen, indem man ausländische Abschlüsse anerkennt oder gezielt Menschen mit Migrationshintergrund anspricht. Eine umfassende Strategie ist der Schlüssel, um den langfristigen Nachwuchsbedarf zu sichern.
Deshalb verlangen die Verbände eine fokussierte Imagekampagne für den Lehrerberuf, bessere Ausbildungsbedingungen und mehr finanzielle Unterstützung für Lehramtsstudierende. Außerdem empfehlen sie, neue Zielgruppen für den Beruf zu erschließen, indem man ausländische Abschlüsse anerkennt oder gezielt Menschen mit Migrationshintergrund anspricht. Eine umfassende Strategie ist der Schlüssel, um den langfristigen Nachwuchsbedarf zu sichern.
Digitalisierung an Schulen: Stand der Technik und bestehende Defizite
Die letzten Jahre haben die Digitalisierung das Bildungswesen grundlegend transformiert; allerdings ist die Umsetzung an Hessens Schulen im Jahr 2025 immer noch eine große Herausforderung. Laut der Sechsten Frankfurter Erklärung sind die digitale Infrastruktur und die technische Ausstattung an vielen Schulen immer noch nicht auf dem nötigen Stand. Vor allem in ländlichen Gebieten mangelt es oft an schnellem Internet, modernen Geräten und funktionierenden IT-Systemen.
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger werden weiterhin gezielt angesprochen, beispielsweise durch verkürzte Qualifizierungsmaßnahmen, Mentoring-Programme und die Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Außerdem untersucht die Landesregierung, ob das Verfahren zur Bewerbung als Lehrkraft vereinfacht und beschleunigt werden kann, um offene Stellen schneller zu besetzen.
Die Verbände reagieren unterschiedlich auf die Maßnahmen. Obwohl viele Initiativen grundsätzlich anerkannt werden, bemängeln die Organisationen das aus ihrer Sicht zu langsame Tempo und die fehlende Verbindlichkeit. Sie verlangen, dass die Praxis stärker in die Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen einbezogen wird, und fordern eine fortlaufende Evaluation der Ergebnisse. Auch im Jahr 2025 ist die politische Diskussion über die Zukunft der Schulen in Hessen ein wichtiges Thema.
Die Verbände reagieren unterschiedlich auf die Maßnahmen. Obwohl viele Initiativen grundsätzlich anerkannt werden, bemängeln die Organisationen das aus ihrer Sicht zu langsame Tempo und die fehlende Verbindlichkeit. Sie verlangen, dass die Praxis stärker in die Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen einbezogen wird, und fordern eine fortlaufende Evaluation der Ergebnisse. Auch im Jahr 2025 ist die politische Diskussion über die Zukunft der Schulen in Hessen ein wichtiges Thema.
IT-Support und technische Unterstützung: Notwendigkeit und Lösungsansätze
Im Jahr 2025 sind die Forderungen der fünf Organisationen, die die Sechste Frankfurter Erklärung unterzeichnet haben, klar und umfassend formuliert. Das zentrale Anliegen ist die Überzeugung, dass Bildung als das wichtigste gesellschaftliches Gut nicht dem Zufall überlassen werden darf. Der Lehrermangel und die Mängel in der Digitalisierung sind Symptome einer strukturellen Unterfinanzierung und einer fehlenden Priorisierung durch den politischen Prozess.
Im Jahr 2025 sind die Forderungen der fünf Organisationen, die die Sechste Frankfurter Erklärung unterzeichnet haben, klar und umfassend formuliert. Das zentrale Anliegen ist die Überzeugung, dass Bildung als das wichtigste gesellschaftliches Gut nicht dem Zufall überlassen werden darf. Der Lehrermangel und die Mängel in der Digitalisierung sind Symptome einer strukturellen Unterfinanzierung und einer fehlenden Priorisierung durch den politischen Prozess.
Die Verbände verlangen einen Masterplan gegen den Lehrermangel, der sowohl kurzfristige als auch langfristige Maßnahmen umfasst. Hierzu gehören das Ausbauen der Ausbildungskapazitäten, die Schaffung gezielter Programme zur Gewinnung von Nachwuchs, finanzielle Anreize für Lehrkräfte in Mangelfächern und ländlichen Gebieten sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch Entlastung und Unterstützung im Alltag. Vor allem die Gründung von multiprofessionellen Teams und die Verbesserung der Schulsozialarbeit gelten als wichtige Elemente.
Die Verbände verlangen einen Masterplan gegen den Lehrermangel, der sowohl kurzfristige als auch langfristige Maßnahmen umfasst. Hierzu gehören das Ausbauen der Ausbildungskapazitäten, die Schaffung gezielter Programme zur Gewinnung von Nachwuchs, finanzielle Anreize für Lehrkräfte in Mangelfächern und ländlichen Gebieten sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch Entlastung und Unterstützung im Alltag. Vor allem die Gründung von multiprofessionellen Teams und die Verbesserung der Schulsozialarbeit gelten als wichtige Elemente.
Im Bereich der Digitalisierung fordern die Verbände, dass alle Schulen umfassend technisch ausgestattet werden, dass es verbindliche Standards für IT-Support gibt und dass es einen nachhaltigen Wartungs- und Investitionsplan gibt. Um die digitale Transformation des Unterrichts zu fördern, sollen Lehrkräfte durch Fortbildungsangebote unterstützt und Austauschplattformen für sie geschaffen werden. Die Verbände heben gleichzeitig hervor, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck ist; sie muss immer die pädagogischen Ziele unterstützen.
Im Bereich der Digitalisierung fordern die Verbände, dass alle Schulen umfassend technisch ausgestattet werden, dass es verbindliche Standards für IT-Support gibt und dass es einen nachhaltigen Wartungs- und Investitionsplan gibt. Um die digitale Transformation des Unterrichts zu fördern, sollen Lehrkräfte durch Fortbildungsangebote unterstützt und Austauschplattformen für sie geschaffen werden. Die Verbände heben gleichzeitig hervor, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck ist; sie muss immer die pädagogischen Ziele unterstützen.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es, die Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten. Die Verbände bitten um gezielte Hilfe für benachteiligte Schulen sowie Schülerinnen und Schüler, um eine weitere soziale Spaltung zu verhindern. Hierzu zählen finanzielle Zuschüsse, zusätzliche Förderprogramme sowie die Unterstützung der digitalen Teilhabe. Es wird ein Aufruf an die Politik ausgesprochen, Bildung als Priorität zu behandeln und ihr ausreichend Mittel bereitzustellen.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es, die Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten. Die Verbände bitten um gezielte Hilfe für benachteiligte Schulen sowie Schülerinnen und Schüler, um eine weitere soziale Spaltung zu verhindern. Hierzu zählen finanzielle Zuschüsse, zusätzliche Förderprogramme sowie die Unterstützung der digitalen Teilhabe. Es wird ein Aufruf an die Politik ausgesprochen, Bildung als Priorität zu behandeln und ihr ausreichend Mittel bereitzustellen.
Ausblick und Forderungen der Verbände: Wege zu einer zukunftsfähigen Schullandschaft
Ohne professionellen IT-Support sind die technischen Einrichtungen der Schulen nicht effektiv nutzbar. In Hessen mangelt es jedoch vielerorts an qualifizierten Fachkräften, die für die Wartung, Pflege und den reibungslosen Betrieb der digitalen Infrastruktur zuständig sind. Die Sechste Frankfurter Erklärung ist unmissverständlich: Lehrkräfte können nicht auch noch die Rolle von IT-Administratoren übernehmen. Aus diesem Grund verlangen die Verbände, dass man zwischen pädagogischen und technischen Verantwortlichkeiten klar unterscheidet.
Ohne professionellen IT-Support sind die technischen Einrichtungen der Schulen nicht effektiv nutzbar. In Hessen mangelt es jedoch vielerorts an qualifizierten Fachkräften, die für die Wartung, Pflege und den reibungslosen Betrieb der digitalen Infrastruktur zuständig sind. Die Sechste Frankfurter Erklärung ist unmissverständlich: Lehrkräfte können nicht auch noch die Rolle von IT-Administratoren übernehmen. Aus diesem Grund verlangen die Verbände, dass man zwischen pädagogischen und technischen Verantwortlichkeiten klar unterscheidet.
Im Jahr 2025 ist zu erkennen, dass die meisten Schulen auf externe IT-Dienste oder engagierte Lehrkräfte angewiesen sind, die diese Aufgaben nebenbei erledigen. Das hat gravierende Auswirkungen: Geräteausfälle, lange Reaktionszeiten bei technischen Störungen und unklare Zuständigkeiten machen den Unterrichtsalltag schwierig. Einer der Hauptgründe, warum digitale Medien im Unterricht seltener oder nur eingeschränkt eingesetzt werden, ist die fehlende technische Unterstützung.
Ein möglicher Lösungsansatz ist es, an jeder Schule oder zumindest innerhalb von Schulverbünden feste IT-Administratorstellen zu schaffen. In den vergangenen Jahren hat die Landesregierung hierzu Modellprojekte initiiert, bei denen Fachkräfte mehrere Schulen unterstützen, indem sie sowohl die technische Wartung als auch die Schulung des Personals übernehmen. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass dies die Zuverlässigkeit der Systeme und die Zufriedenheit der Lehrkräfte erheblich verbessert.
Ein anderes Modell besteht darin, mit regionalen IT-Dienstleistern zusammenzuarbeiten, die im Auftrag der Schulträger einen regelmäßigen Support bieten. Eine klare Aufgabenverteilung, eine verlässliche Erreichbarkeit und eine ausreichende Finanzierung sind jedoch entscheidend. Die Verbände verlangen, dass diese Modelle landesweit ausgeweitet und verbindliche Standards für die technische Unterstützung an Schulen geschaffen werden.
Neben dem IT-Support sind auch Schulungen für Lehrkräfte erforderlich, damit sie den Umgang mit neuen Geräten und Anwendungen sicher beherrschen. Um sich in den Schulalltag integrieren zu lassen, ist es wichtig, dass Praxisnah und zeitlich flexible Fortbildungsangebote sind. Die Bereitstellung von Handbüchern, Online-Tutorials und kollegialen Austauschplattformen kann helfen, Hemmschwellen abzubauen und die digitale Kompetenz im Kollegium zu fördern.
Um die Schulen erfolgreich zu digitalisieren, ist es unerlässlich, dass wir einen professionellen IT-Support sicherstellen. Ohne diese Hilfe laufen kostspielige Investitionen ins Leere und die Lehrkräfte verlieren weiter ihre Motivation. Die Verbände empfinden hier einen dringenden Handlungsbedarf und verlangen, dass die Landesregierung dies klar priorisiert.
Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit: Auswirkungen von Lehrermangel und Digitalisierung
In Hessen sind die Bildungsgerechtigkeit und die Chancengleichheit direkt betroffen durch den Lehrermangel und die ungleiche Digitalisierung der Schulen. Im Jahr 2025 wird deutlich, dass die Ungleichheit zwischen gut ausgestatteten Schulen in wohlhabenden Gegenden und den benachteiligten Bildungseinrichtungen immer größer wird. Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien oder mit Migrationshintergrund sind besonders stark von den strukturellen Defiziten betroffen.
Oftmals führt Lehrermangel dazu, dass Unterricht ausfällt oder von Personen ohne Fachkenntnis übernommen wird. Vor allem Schulen in sozialen Brennpunkten sind hiervon betroffen; sie kämpfen ohnehin mit besonderen Herausforderungen wie Sprachförderung, Integration und sozialer Benachteiligung. Die Kontinuität des Unterrichts spielt eine entscheidende Rolle, um Bildungsrückstände aufzuholen und individuelle Förderung zu ermöglichen. Ohne das Vorhandensein von qualifizierten Lehrkräften droht die Gefahr, dass sich Bildungsungleichheiten weiter verfestigen.
Selbst im Bereich der Digitalisierung ist eine soziale Spaltung erkennbar. Während einige Schulen mit moderner Technik und einem funktionierenden IT-Support ausgestattet sind, kämpfen andere mit veralteten Geräten, fehlendem Internet und mangelnder technischer Hilfe. Schülerinnen und Schüler, die zu Hause weder digitale Endgeräte noch einen ruhigen Arbeitsplatz haben, sind besonders betroffen. In den Pandemie-Jahren hat sich diese Problematik verschärft und die digitale Teilhabe ist seither ein entscheidender Faktor für den Bildungserfolg geworden.
Die Verbände machen deutlich, dass die Schulpolitik unbedingt die Bildungsgerechtigkeit in den Fokus nehmen sollte. Sie fordern spezielle Förderprogramme für benachteiligte Schulen, die zusätzliche Lehrkräfte, moderne technische Ausstattung und professionelle Unterstützung umfassen. Hierzu gehören finanzielle Zuschüsse für die Anschaffung von Geräten, das Bereitstellen von Lernsoftware und das Einrichten von Lernzentren, in denen Schülerinnen und Schüler individuell unterstützt werden können.
Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass wir die digitalen Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler stärken. Ein fester Bestandteil des Unterrichts sollte die Lehre über Medienkompetenz, kritisches Denken und ein verantwortungsbewusster Umgang mit digitalen Medien sein. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen auf Teilhabe an der digitalen Gesellschaft haben.
Um Bildungsgerechtigkeit zu sichern, brauchen wir ein umfassendes Maßnahmenpaket, das über kurzfristige Lösungen hinausgeht. Eine langfristige Strategie, die den Bedürfnissen benachteiligter Schulen besondere Aufmerksamkeit schenkt, ist laut den Verbänden unerlässlich, um die Chancengleichheit im hessischen Bildungssystem nachhaltig zu verbessern.
Politische Reaktionen und Maßnahmen: Was tut die Landesregierung?
Im Jahr 2025 wird die hessische Landesregierung zunehmend gefordert sein, auf die Anliegen der Verbände zu reagieren und wirkungsvolle Maßnahmen gegen den Lehrermangel sowie die Defizite in der Digitalisierung zu ergreifen. Obwohl in den letzten Monaten mehrere Initiativen gestartet wurden, bleibt die Kritik an Tempo und Umfang ihrer Umsetzung bestehen.
Eine wichtige Maßnahme ist es, die Anzahl der Lehramtsstudienplätze an den hessischen Universitäten zu erhöhen. Es werden bereits zum Wintersemester 2025/26 zusätzliche Kapazitäten, vor allem für Grundschul- und MINT-Fächer, geschaffen. Außerdem gibt es finanzielle Anreize für Lehramtsstudierende in Mangelfächern, wie Stipendien und vergünstigte Wohnheimplätze. Das Ziel ist es, mehr junge Leute für das Lehramtsstudium zu begeistern und den Beruf attraktiver zu gestalten.
Im Bereich der Digitalisierung hat die Landesregierung angekündigt, den Digitalpakt Schule zu verlängern und zusätzliche Mittel für die technische Ausstattung bereitzustellen. Das Ziel ist es, Schulen flächendeckend mit schnellem Internet, modernen Endgeräten und interaktiven Whiteboards auszustatten. Außerdem ist es geplant, den IT-Support durch die Schaffung von 500 neuen Administratorstellen landesweit zu verbessern. Die ersten Pilotprojekte, die gemeinsam mit Kommunen und privaten IT-Dienstleistern umgesetzt werden, sind bereits am Laufen und sollen bis Ende 2025 bewertet werden.
Um Lehrkräfte zu entlasten, werden neue Schulsozialarbeiter*innen und Stellen in multiprofessionellen Teams geschaffen. Fortbildungsangebote zur Digitalisierung und zu pädagogischen Innovationen will die Landesregierung ebenfalls ausbauen. Ab 2026 wird ein neues Landesinstitut für Lehrerfortbildung als zentrale Anlaufstelle fungieren und den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis unterstützen.
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger werden weiterhin gezielt angesprochen, zum Beispiel durch verkürzte Qualifizierungsmaßnahmen, Mentoring-Programme und die Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Um offene Stellen schneller zu besetzen, schaut die Landesregierung auch, ob das Bewerbungsverfahren für Lehrkräfte einfacher und schneller gestaltet werden kann.
Die Verbände reagieren unterschiedlich auf die Maßnahmen. Obwohl viele Initiativen grundsätzlich anerkannt werden, bemängeln die Organisationen das aus ihrer Sicht zu langsame Tempo und die fehlende Verbindlichkeit. Sie verlangen, dass die Praxis stärker in die Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen einbezogen wird und dass es eine fortlaufende Evaluation der Ergebnisse gibt. Auch im Jahr 2025 bleibt die politische Diskussion über die Zukunft der Schulen in Hessen ein wichtiges Thema.
Ausblick und Forderungen der Verbände: Wege zu einer zukunftsfähigen Schullandschaft
Im Jahr 2025 sind die Forderungen der fünf Organisationen, die die Sechste Frankfurter Erklärung unterzeichnet haben, klar und umfassend formuliert. Das zentrale Anliegen ist die Überzeugung, dass Bildung als das wichtigste gesellschaftliches Gut nicht dem Zufall überlassen werden darf. Man betrachtet den Lehrermangel und die Mängel in der Digitalisierung als Anzeichen für eine strukturelle Unterfinanzierung und dafür, dass Bildungspolitik nicht prioritär behandelt wird.
Die Verbände verlangen einen Masterplan gegen den Lehrermangel, der sowohl kurzfristige als auch langfristige Maßnahmen umfasst. Hierzu gehören das Erhöhen der Ausbildungskapazitäten, das Schaffen gezielter Programme zur Nachwuchsgewinnung, finanzielle Anreize für Lehrkräfte in Mangelfächern und ländlichen Gebieten sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch Entlastung und Unterstützung im Alltag. Vor allem die Gründung von multiprofessionellen Teams und die Stärkung der Schulsozialarbeit gelten als wichtige Elemente.
Im Bereich der Digitalisierung verlangen die Verbände eine flächendeckende technische Ausstattung aller Schulen, verbindliche Standards für IT-Support und einen nachhaltigen Wartungs- und Investitionsplan. Fortbildungsangebote für Lehrkräfte sollen eingerichtet und Austauschplattformen ausgebaut werden, um die digitale Transformation des Unterrichts zu fördern. Die Organisationen heben jedoch hervor, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck ist; sie muss immer die pädagogischen Ziele unterstützen.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es, die Bildungsgerechtigkeit zu sichern. Die Verbände bitten um gezielte Hilfe für benachteiligte Schulen sowie Schülerinnen und Schüler, um die soziale Spaltung nicht weiter zu verschärfen. Das umfasst finanzielle Zuschüsse, zusätzliche Förderprogramme sowie die Unterstützung digitaler Teilhabe. Die Politik sollte Bildung als Priorität behandeln und ausreichend Mittel bereitstellen.
Die Organisationen heben hervor, dass es einen stetigen Austausch zwischen Politik, Verbänden, Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern braucht. Ein zukunftssicheres Bildungssystem, das den Bedürfnissen der Gesellschaft im Jahr 2025 und darüber hinaus gerecht wird, kann nur entstehen, wenn alle Beteiligten eng zusammenarbeiten. Die Sechste Frankfurter Erklärung sieht sich als Anstoß und Aufforderung, die Herausforderungen mutig anzugehen und die hessische Schullandschaft nachhaltig zu verbessern.




